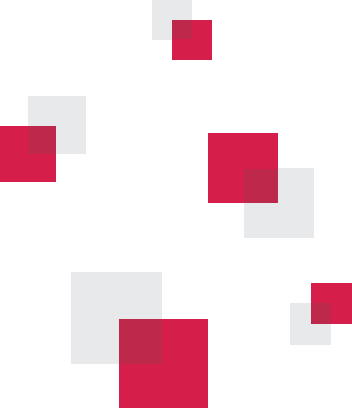Internationale Metaanalysen schätzen, dass weltweit etwa 15 bis 20 Prozent der Mädchen und rund acht Prozent der Jungen von sexuellem Missbrauch betroffen sind; vergleichbare Zahlen liegen auch für die Schweiz vor. Das Erleben sexuellen Missbrauchs verursacht grosses Leid und ist ein empirisch gut belegter Risikofaktor für die Beeinträchtigung der psychischen und allgemeinen Gesundheit. Die damit verbundenen gesellschaftlichen Kosten belaufen sich international auf vielfache Milliardenbeträge.
Der Prävention sexuellen Missbrauchs kommt eine hohe gesellschaftliche Priorität zu. Es liegt in der Pflicht des Staates, Kinder und Jugendliche vor Verletzungen ihrer physischen, psychischen und sexuellen Integrität zu schützen.
Sexuelle Neigung vs. tatsächliche sexuelle Handlungen an Kindern Zwei wesentliche Gruppen von Risikofaktoren für Täterschaft bei Straftaten gegen die sexuelle Integrität von Kindern werden im Motivation-Facilitation-Modell zur Erklärung von Sexualdelinquenz beschrieben: Es sind dies motivationale und enthemmende Faktoren, deren gemeinsames Auftreten das Risiko erhöhen (Seto 2019). Enthemmend wirken beispielsweise eine generelle Antisozialität, aber auch kurzfristig variierende Faktoren wie etwa Alkoholisierung. Sexuelle Präferenzen für Kinder, die internationalen Schätzungen zufolge etwa ein Prozent der männlichen Allgemeinbevölkerung aufweisen, sind dabei einer von mehreren motivationalen Faktoren, die das Risiko für die Ausübung einer Sexualstraftat zum Nachteil von Kindern steigern, jedoch ohne weitere Risikofaktoren keineswegs zwangsläufig zu einer solchen führen. Etwa 60 Prozent dieser Straftaten werden von Personen begangen, die keine entsprechende Neigung aufweisen. Das heisst: Nicht alle Personen, die sich wegen sexueller Handlungen mit Kindern strafbar machen, haben sexuelles Interesse an Kindern (pädophile Neigung) oder Jugendlichen (hebephile Neigung), und nicht alle Personen mit einer solchen Neigung begehen sexuelle Handlungen an Kindern oder Jugendlichen. Die sexuelle Neigung gilt als unveränderbar, das sexuelle Verhalten hingegen als grundsätzlich kontrollierbar. Allerdings gehören Personen mit sexuellen Interessen an Kindern und Jugendlichen aufgrund des von der Öffentlichkeit und teilweise auch von Fachleuten überschätzten Zusammenhangs zwischen dieser Neigung und dem sexuellen Missbrauch von Kindern zu den gesellschaftlich am meisten stigmatisierten Personengruppen. Aufgrund dieser Stigmatisierung stehen Betroffene unter einer hohen psychischen Belastung, die wiederum zu einem indirekten Risikofaktor für das Begehen von sexuellen Handlungen an Kindern werden kann (Jahnke et al. 2015).
Sekundärprävention und Forschungsauftrag Sekundärpräventive Massnahmen richten sich an Personen mit sexuellen Interessen an Kindern und Jugendlichen, die unter ihrer sexuellen Neigung leiden oder befürchten, zukünftig Kinder zu missbrauchen. Aufgrund ihres Leidensdrucks haben diese oft von sich aus ein Interesse an Beratung und Behandlung und bilden daher eine vergleichsweise gut erreichbare und von sich aus motivierte Zielgruppe präventiver Massnahmen. Die Konzentration der Präventionsbemühungen auf diese Zielgruppe erscheint vor diesem Hintergrund plausibel, wohingegen etwa potenzielle Sexualstraftäter und -täterinnen ohne entsprechende Neigung, aber mit ausgeprägter Antisozialität, mangels Leidensdrucks schwieriger motivierbar für entsprechende Angebote sind.
Das Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (sog. Lanzarote-Konvention, SR 0.311.40, in Kraft seit 1. Juli 2014) verpflichtet die Vertragsstaaten in Artikel 7 dazu sicherzustellen, dass Personen, die befürchten, eine entsprechende Straftat zu begehen, Zugang zu wirksamen präventiven Interventionsmassnahmen erhalten, die dazu beitragen, die Gefahr der Begehung einer solchen Straftat zu vermindern. Im nachfolgenden Artikel werden die wichtigsten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zusammengefasst, die eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) erarbeitet hat (Niehaus et al. 2020). Ihre Aufgabe war es, einen Überblick über entsprechende Präventionsangebote in der Schweiz und im Ausland zu erarbeiten und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu deren Wirksamkeit zusammenzutragen, sowie die Rolle und Wirkung von Interventionen niedergelassener Behandlerinnen und Behandler darzulegen. Hierzu wurden Präventionsangebote untersucht, die anhand einer systematischen Internetrecherche und einer Literaturanalyse identifiziert worden waren, und Erkenntnisse zu deren Wirksamkeit gesammelt. Des Weiteren erfolgten fünfzehn qualitative Interviews mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten sowie eine Online-Befragung von 427 Psychiaterinnen und Psychiatern, Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Sexologinnen und Sexologen, die in der Schweiz praktizieren. Die Fragen betrafen deren Kenntnisse, Erfahrungen und Einstellungen sowie die Bereitschaft zur Behandlung der Zielgruppe.
Wirksamkeit von Sekundärprävention Sekundärpräventive Angebote für Personen mit sexuellem Interesse an Kindern und Jugendlichen lassen sich danach unterteilen, ob sie ausschliesslich beratend und vermittelnd wirken oder eine direkte therapeutische Behandlung vorsehen. Obschon beiden Formen sekundärpräventiver Angebote eine hohe Augenscheinvalidität zu attestieren ist – d. h. sie erscheinen valide, weil sie plausibel wirken –, gibt es aus wissenschaftlicher Sicht nach dem aktuellen Stand der Forschung aussagekräftige empirische Belege weder für noch gegen eine spezifische kriminalpräventive Wirksamkeit im Sinne einer Verhinderung zukünftigen sexuellen Kindesmissbrauchs oder des Konsums von Missbrauchsabbildungen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass ein solcher Nachweis für diese spezielle Zielgruppe mit einem geringen Ausgangsrisiko für Delinquenz (Behandlungsinteressierte sind problemeinsichtig und von sich aus motiviert, keine Übergriffe zu begehen) methodisch besonders schwierig ist. Nichtsdestotrotz zeigen die Erfahrungen mit den Nutzungsraten internationaler Angebote, dass sowohl für Helplines wie z. B. STOP IT NOW! als auch für das umfassende Behandlungsangebot der deutschen «Kein Täter werden»-Programme ein Bedarf besteht. Darüber hinaus gibt es auch eine ethische Verpflichtung, hilfesuchenden Personen Angebote zu machen, die ihren Leidensdruck verringern können. Trotz methodischer Herausforderungen wird es zukünftig allerdings aus sicherheitspolitischen wie auch aus ethischen Gründen erforderlich sein, die Wirksamkeit sekundärpräventiver Behandlungsangebote einer geeigneten strengen empirischen Prüfung zu unterziehen, um sowohl deren Wirksamkeit bestätigen als auch etwaige negative Effekte ausschliessen zu können.
Was erwartet Behandlungsinteressierte auf der Suche nach einer Therapiemöglichkeit? Auf Basis der vorliegenden Befunde kann davon ausgegangen werden, dass bei Personen mit sexuellem Interesse an Kindern und Jugendlichen aufgrund des Stigmatisierungsstresses, der auf ihnen lastet, ein erhöhter Beratungs- bzw. Behandlungsbedarf besteht. Da sich Betroffene nicht immer direkt an spezialisierte Präventionsangebote wenden können, sondern zumeist auch niedergelassene Gesundheitsfachpersonen aufsuchen, kommt Letzteren bei der Prävention eine zentrale Rolle zu. Internationale Befragungen Betroffener weisen allerdings darauf hin, dass sich die Suche nach qualifizierten Therapeuten ausgesprochen schwierig gestaltet, da auch unter diesen ausgeprägte Ressentiments gegenüber Personen mit sexuellen Interessen an Kindern existieren und die Behandlungsbereitschaft dementsprechend gering ist. Schliesslich berichten Personen mit sexuellem Interesse an Kindern und Jugendlichen international von einer Inkompatibilität von eigenen Bedürfnissen und den Therapiezielen der Behandelnden: Betroffene scheinen vor allem daran interessiert, besser mit den für sie beeinträchtigenden Alltagsfolgen ihrer stigmatisierenden Neigung umgehen zu lernen, während die Behandelnden eher die Kontrolle des potenziellen Risikos für sexuellen Kindesmissbrauch anzustreben scheinen. Entsprechend erlebt nur rund die Hälfte der Betroffenen die professionelle Hilfe, um die sie sich bemüht hat, als hilfreich. Die wahrgenommene Stigmatisierung der Betroffenen durch Therapeuten und die Risikofokussierung der Behandlungsangebote verringert bei an sich behandlungswilligen Personen die Bereitschaft, ihre Probleme gegenüber einer Fachperson offenzulegen. Dies kann zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit führen, was wiederum zu einem erhöhten Risiko beitragen kann, Handlungen gegen die sexuelle Integrität von Kindern zu begehen.
Die Befunde der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass auch unter Schweizer Therapeuten grosse Unsicherheit und wenig Erfahrung mit dieser Zielgruppe vorliegen, dafür aber deutliche Ressentiments gegenüber Betroffenen festzustellen sind. Stigmatisierende Einstellungen seitens Behandelnder stellen ein erhebliches Behandlungshindernis dar. So gaben von den schweizweit befragten Therapeuten 58 Prozent an, noch nie eine Person mit pädophilen Interessen behandelt zu haben, 14 Prozent berichteten, bisher erst eine solche Person behandelt zu haben. Drei Viertel der befragten Fachpersonen gaben an, Betroffene im Falle einer Kontaktaufnahme weiterverweisen zu wollen, wobei jede fünfte bis sechste Person mitteilte, kein entsprechendes Angebot zu kennen. Knapp 85 Prozent der befragten Fachpersonen gaben zudem an, sich nicht spezifisch fortgebildet zu haben. Fachpersonen mit spezifischen Kenntnissen gaben an, diese in erster Linie via Supervision und Selbststudium und nicht im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung erworben zu haben. Insgesamt ist die Behandlungsbereitschaft niedergelassener Therapeuten als ausgesprochen gering zu bezeichnen. Nur 15 Prozent der Befragten bejahten ihre Behandlungsbereitschaft im Hinblick auf nicht übergriffige Personen mit entsprechender Neigung eindeutig. Bei Betroffenen, die angaben, bereits einmal einen sexuellen Missbrauch begangen zu haben, reduzierte sich dies auf neun Prozent. Stigmatisierende Einstellungen, wie beispielsweise Wünsche nach sozialer Distanz zu Betroffenen oder Personen mit dieser Neigung zu bestrafen, standen mit Behandlungsvorbehalten in einem deutlichen Zusammenhang. Diese Befunde lassen erwarten, dass Betroffene auch in der Schweiz Schwierigkeiten haben, behandlungsbereite Therapeuten zu finden. Aussagen der befragten Experten bestätigen diese Vermutung.
Handlungsbedarf in der Schweiz Dem Lanzarote- Abkommen würde die Schweiz dann gerecht werden, wenn
a) Hilfesuchende mit pädophiler oder hebephiler Neigung wüssten, an wen sie sich mit ihrem Anliegen wenden können,
b) diese Fachkräfte über einschlägige Kenntnisse verfügten und dazu bereit wären, mit den Betroffenen zu arbeiten, und
c) die Fachkräfte auf wirksame Interventionsansätze zurückgriffen.
Die Befunde der vorliegenden Studie zeigen deutlich, dass diese Bedingungen in der Schweiz gegenwärtig weder bei den reinen Beratungs- noch bei den Behandlungsangeboten erfüllt sind (vgl. Tabelle T1).
Behandlung und Therapie für Personen mit sexuellem Interesse an Kindern T1
| Sprachregion | Angebotsfokus | Angebot/Website |
| Deutsch-schweiz | Therapiemöglichkeit | Forio : www.keinmissbrauch.ch |
| Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel: www.upk.ch > Abklärungs- und Behandlungsangebot für Menschen mit Abweichung der sexuellen Orientierung (PDF) |
||
| Westschweiz | Beratung | Association DIS NO : www.disno.ch |
| Possibilité de traitement | Hôpitaux Universitaires de Genève : www.hug.ch > Consultation de sexologie |
|
| Centre hospitalier universitaire vaudois : www.chuv.ch > Consultation Claude Balier |
||
| Tessin | Beratung | Associazione io-NO! : www.io-no.ch |
Quelle: Niehaus et al. 2020.
Bei den reinen Beratungsangeboten erscheint das Westschweizer DIS NO gemessen an internationalen Angeboten und empfehlenswerten Rahmenbedingungen (anonym, kostenfrei, zielgruppengerecht, explizite Ansprache Jugendlicher mit pädophiler Neigung) vergleichsweise gut aufgestellt. Im Tessin ist ein Angebot nach dem Vorbild von DIS NO gerade im Aufbau (io NO). In der Deutschschweiz fehlt das entsprechende Pendant.
Es zeigt sich zudem, dass die reinen Beratungsangebote Schwierigkeiten haben, qualifizierte und behandlungsbereite Therapeuten zu finden, um behandlungswillige Personen weiterzuleiten. Die Befragung Schweizer Psychiater, Psychotherapeuten und Sexologen verdeutlicht, dass die Befragten überwiegend eine geringe Behandlungsbereitschaft bezüglich Personen mit dieser Problematik aufweisen, eigener Einschätzung nach nicht über die notwendigen Kompetenzen verfügen und unsicher hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit sind.
In der Schweiz existiert kein strukturiertes, alle Sprachregionen umfassendes Behandlungsangebot für behandlungswillige Personen mit sexuellem Interesse an Kindern und Jugendlichen (vgl. Tabelle T1). Bei den bestehenden Angeboten handelt es sich um Einzelinitiativen und, mit Ausnahme eines Angebots in der Deutschschweiz, um wenig spezifische Therapieangebote, deren Anbieter nicht systematisch vernetzt sind. Es fehlen gemeinsame prozedurale Standards bezüglich Zielgruppen, Rahmenbedingungen der Behandlung, Umgang mit Anonymität und Meldungen an Behörden sowie eine gesamtschweizerische Koordination der Angebote. Keines der Schweizer Präventionsangebote wurde bisher wissenschaftlich evaluiert. Zudem sind die Angebote teilweise nur schwer auffindbar, Massnahmen zur Bekanntmachung der Angebote in der Öffentlichkeit sind bisher weitgehend nicht erfolgt.
Alle Angebote mit Behandlungsoption sind der theoretischen Ausrichtung des Behandlungsansatzes nach primär an der Straftäterbehandlung orientiert, was die Eingangsschwelle für nicht delinquente Personen erhöhen dürfte. Die Therapien zielen in erster Linie auf die Verhinderung zukünftiger Straftaten, sie orientieren sich weniger am Leidensdruck der Betroffenen. Jugendliche werden als wesentliche Betroffenengruppe nur von einem Angebot explizit angesprochen. Im Tessin gibt es kein Präventionsangebot mit direkter Behandlungsmöglichkeit. Die erforderliche Anonymität ist bei keinem der Behandlungsangebote gewährleistet. In der Schweiz können nur finanziell besser gestellte Personen anonym bleiben, indem sie die Kosten des Angebots selbst tragen.
Massnahmen gegen die Lücken im Beratungs- und Therapieangebot
In der Schweiz bestehen Lücken beim Beratungs- und Therapieangebot für Personen mit sexuellen Interessen an Kindern. Dies hält der Bundesrat in einem Bericht fest, den er am 11. September 2020 verabschiedet hat. Er ist bereit, in allen Sprachregionen ein Beratungsangebot zu subventionieren und auch die schweizweite Koordination des Angebots zu unterstützen. Zudem soll in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung, den für die Weiter- und Fortbildung von Psychologinnen und Psychologen zuständigen Berufsverbänden sowie den medizinischen Fachgesellschaften geprüft werden, wie das Thema der pädophilen Neigung, der Stigmatisierung der Betroffenen sowie der Prävention von sexuellen Handlungen mit Kindern noch stärker in die Weiter- und Fortbildung von Fachpersonen des Gesundheitswesens integriert werden könnte. Für die Bereitstellung eines ausreichenden Therapieangebots sind hingegen die Kantone zuständig.
Was ist zu tun? Um die Lücken im Beratungs- und Therapieangebot zielführend anzugehen, wäre ein strukturiertes und ein vom Bund in allen Sprachregionen koordiniertes Behandlungsangebot mit regionalen Behandlungszentren aufzubauen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Bedürfnislagen empfehlen wir, spezifische Behandlungsmodule für unterschiedliche Zielgruppen (z. B. Jugendliche, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung) und Risikokonstellationen anzubieten. Das Zusammenbringen forensisch zugewiesener und nicht delinquenter Personen in Therapiegruppen, wie es derzeit beim Angebot des Forio praktiziert wird, ist unbedingt zu vermeiden. Denn bei Personen mit geringem Ausgangsrisiko muss unter diesen Bedingungen sogar mit der Möglichkeit negativer Behandlungseffekte gerechnet werden. Die Behandlungsformen sollten innerhalb des Netzwerks der regionalen Behandlungsangebote aufeinander abgestimmt sein und wichtige Rahmenbedingungen (z. B. Aufnahmebedingungen, Vorgehen bei Bekanntwerden oder Risiko zukünftiger Straftaten, Qualitätssicherung) über alle Standorte hinweg gleich gehandhabt werden. Zu empfehlen ist eine klinische anstatt einer forensischen Anbindung. Die Behandlungskosten sollten von den Krankenkassen übernommen werden, und das Behandlungsangebot sollte anonym in Anspruch genommen werden können. Andernfalls werden wirtschaftlich schwache Personen und damit insbesondere Jugendliche nicht erreicht. Auch in der Deutschschweiz sollte es zudem, wie in den anderen Landesteilen, eine anonyme Helpline mit Triage-Funktion geben, die kostenfrei aus allen Netzen erreichbar ist. Zur Bekanntmachung der Angebote wird eine öffentlichkeitswirksame Medienkampagne empfohlen, die zugleich als Anti-Stigma-Intervention wirkt und die sinnvollerweise ebenfalls durch den Bund erfolgen sollte.
Hierzu sollte eine vom Bund zur wissenschaftlichen Begleitung der Behandlungsangebote zentral eingesetzte, unabhängige Evaluationsstelle EDV-gestützt systematisch Behandlungsdaten anonymisiert erheben, archivieren und auswerten, um die u. a. im Hinblick auf Fallzahlen notwendigen Voraussetzungen für eine aussagekräftige Wirkungsevaluation zu schaffen. Da es aufgrund der starken Ressentiments in der Bevölkerung kaum eine realistische Option darstellt, von privater Seite ausreichende Mittel zu erhalten, solange Organisationen einen Imageschaden fürchten müssen, wenn sie solche Präventionsmassnahmen finanziell unterstützen, wird die Umsetzung einer Anschubfinanzierung durch den Bund und die Kantone bedürfen.
Nicht zuletzt ist dafür Sorge zu tragen, dass niedergelassene Therapeuten und andere Fachpersonen des Gesundheitswesens über Basiswissen bezüglich pädophiler Neigungen verfügen, das sie in die Lage versetzt, Problemlagen zu erkennen, angemessen mit Betroffenen in Kontakt zu treten und diese an geeignete Experten weiterverweisen zu können. Letzteres macht eine Aufnahme entsprechender Lehrinhalte in die jeweiligen Aus- und Fortbildungscurricula erforderlich. Wer therapeutisch mit Betroffenen arbeiten möchte, benötigt neben einer anerkannten Therapieausbildung eine spezifische Weiterbildung, in deren Rahmen sich die Teilnehmenden neben der Aneignung spezifischen Fachwissens auch intensiv mit eigenen stigmatisierenden Einstellungen auseinandersetzen und sich bewusst machen, dass Stigmatisierung die Behandlungsbereitschaft sowohl auf Seiten der Behandelnden als auch auf Seiten der Betroffenen verringert.
Klar ist: Eine Gesellschaft, die Personen mit pädophilen Neigungen stigmatisiert, indem sie eine sexuelle Ausrichtung auf Kinder mit Täterschaft gleichsetzt, vergibt sich Chancen, das sexuelle Missbrauchsrisiko von Kindern zu senken.
- Literatur
- Bundesrat (2020): Präventionsangebote für Personen mit sexuellen Interessen an Kindern. Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate Rickli Natalie 16.3637 und Jositsch Daniel 16.3644 «Präventionsprojekt ‹Kein Täter werden› für die Schweiz» vom 12. September 2016: www.bsv.admin.ch > Publikationen & Services > Bundesratsberichte > 2020.
- Niehaus, Susanna; Pisoni, Delia; Schmidt, Alexander F. (2020): Präventionsangebote für Personen mit sexuellen Interessen an Kindern und ihre Wirkung; [Bern: BSV]. Beiträge zur sozialen Sicherheit; Forschungsbericht Nr. 4/20: www.bsv.admin.ch > Publikation & Service > Forschung und Evaluation > Forschungspublikationen.
- Seto, Michael C. (2019): «The motivation-facilitation model of sexual offending», in Sexual Abuse 31, Nr. 1, 3 ff.
- Jahnke, Sara; Schmidt, Alexander F.; Geradt, Maximilian; Hoyer, Jürgen (2015): «Stigma-related stress and its correlates among men with pedophilic sexual interests», in Archives of Sexual Behavior 44, Nr. 8, 2173 ff.