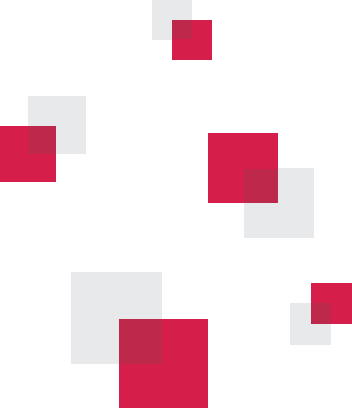Aus Befragungsstudien wissen wir, dass ungefähr 25 Prozent aller Mädchen und Jungen, die in der Schweiz aufwachsen, irgendwann in ihrer Kindheit und Jugend Gewalt durch die eigenen Eltern erfahren – seien es körperliche, emotionale oder sexuelle Übergriffe. Rund ein Zehntel aller Kinder und Jugendlichen sieht zudem mit an, wie ein Elternteil dem anderen Gewalt zufügt (Lätsch/Stauffer 2016). Für die Betroffenen sind solche Erfahrungen oft in hohem Mass belastend, lösen Leidensdruck aus und führen zu einer Beeinträchtigung ihrer Entwicklung und damit zu psychischen und sozialen Auffälligkeiten im weiteren Lebensverlauf. Genauere Zahlen dazu, wie viele von ihnen jemals Hilfe von aussen erhalten, liegen nicht vor. Plausible Schätzungen legen allerdings nahe, dass es sich nur um einen Bruchteil aller von innerfamiliärer Gewalt betroffenen Kinder und Jugendlichen handelt. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen dringt oft nicht nach aussen, was sich in der Familie abspielt. Zum anderen wissen Aussenstehende, auch wenn sie von der Gewalt etwas mitbekommen, häufig nicht, wie mit der Situation umzugehen ist. Ratlos, was sie tun könnten, tun sie so, als hätten sie nichts bemerkt. Das kann auf Privatpersonen aus dem Umfeld der Familie zutreffen, aber auch auf Fachleute wie Lehrkräfte, Sozialarbeitende oder Ärzte und Ärztinnen. Klar ist: Praxis und Wissenschaft müssen dringend dazulernen, wo es um professionelle Strategien zur frühzeitigen Erkennung von innerfamiliärer Gewalt geht.
Im Auftrag des BSV wurde untersucht, welche Massnahmen getroffen werden können, um das skizzierte Problem anzugehen. Genauer ging es um die Frage, wie Fachpersonen aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereich dazu beitragen können, dass innerfamiliäre Gewalt häufiger und zuverlässiger möglichst frühzeitig erkannt wird (Krüger et al. 2018). Zur Untersuchung wurde ein multimethodisches Forschungsdesign gewählt. Bestandteile waren eine Übersicht über die internationale Literatur, eine Internetrecherche und Dokumentenanalyse zu Früherkennungsinstrumenten sowie zu Empfehlungen zur Früherkennung, die in der Schweiz und international verwendet bzw. ausgesprochen werden. Zudem wurden die Curricula thematisch relevanter Aus-, Weiter- und Fortbildungsangebote im Gesundheitsbereich analysiert sowie elf nationale und internationale Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des Kindesschutzes interviewt. Überdies gaben 159 Fachpersonen aus der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung der Schweiz im Rahmen einer telefonischen Befragung Auskunft zu ihrer Praxis.
International: keine Best Practice Die Auseinandersetzung mit der internationalen Literatur zeigt, dass das skizzierte Problem der Unterversorgung und die ungenügende Erkennung innerfamiliärer Gewalt nicht nur ein schweizerisches Phänomen ist. Bezogen auf die Gesundheitsversorgung und benachbarte Felder existiert bisher keine breit anerkannte Best Practice zur Frage, wie die Früherkennung innerfamiliärer Gewalt kontextübergreifend zu organisieren wäre. Der Konsens unter den Autorinnen und Autoren ist insofern primär ein sokratischer: Man weiss, dass man viel zu wenig weiss – ein Standpunkt, der auch von den befragten Expertinnen und Experten geteilt wird. Es lassen sich aber zumindest einige Probleme benennen, die der Ausarbeitung einer Best Practice im Weg stehen. Da ist erstens die Kontextabhängigkeit: Professionelle Akteure in der Gesundheitsversorgung, im Bildungssystem, in der Kinder- und Jugendhilfe usw. unterscheiden sich erheblich darin, wann, wie oft, wie lange, wie intensiv, in welcher Funktion, mit welchen Zielen sie in Kontakt mit Familien kommen. Deshalb lassen sich kaum Früherkennungsmassnahmen entwickeln und evaluieren, die über die Grenzen eines Handlungsfeldes oder einer professionellen Funktion hinaus eingesetzt werden könnten. Innerhalb einzelner, abgrenzbarer Handlungsfelder, die sich für ein einheitliches Vorgehen anbieten, kommt zweitens ein in der medizinischen und psychosozialen Diagnostik wohlbekanntes Problem hinzu: Mit dem Einsatz von Instrumenten, die darauf ausgerichtet sind, möglichst viele Fälle eines bestimmten Problems zu erkennen (sog. richtig-positive Diagnosen), wächst in der Regel das Risiko falscher Problemzuschreibungen (sog. falsch-positive Diagnosen). Bezogen auf die Erkennung innerfamiliärer Gewalt bedeutet dies, dass auch mehr Eltern, die ihren Kindern keine Gewalt zufügen oder als miterlebte zumuten, unter falschen Verdacht geraten.
Besonders ausgeprägt ist dieses Risiko bei universellen Screenings. Mit diesem Begriff sind Früherkennungsinstrumente gemeint, die bei allen Menschen in der jeweiligen Zielgruppe zum Einsatz kommen, unabhängig davon, ob sich zuvor bereits Anhaltspunkte für innerfamiliäre Gewalt ergeben haben oder nicht – beispielsweise das routinemässige Stellen standardisierter Fragen im Rahmen kinderärztlicher Vorsorgeuntersuchungen. Die Befunde der wenigen Studien, die sich bisher mit den Auswirkungen solcher universellen Screenings auseinandergesetzt haben, sind widersprüchlich. So wird einerseits jenseits des Risikos falsch-positiver Diagnosen darauf hingewiesen, dass die Vertrauensbeziehung zwischen der Fachperson und den Eltern belastet werden könne; andererseits zeigen Studien, dass Fragen nach Gewalterfahrungen von Patientinnen dann gut akzeptiert werden, wenn diese wissen, dass die Fragen allen gestellt werden. Bei einem transparenten oder erkennbaren Screening ist aber auch mit Verleugnungstendenzen zu rechnen: Weil das Thema moralisch und rechtlich sensibel und für das Selbstverständnis von Eltern zentral ist, werden Antworten von Selbstpräsentationsstrategien geleitet. Zudem stellt sich die Frage, wie mit Antwortverweigerung umzugehen ist und ob es ein Recht hierauf gibt. Und wenn ja, wie kann sichergestellt werden, dass seine Inanspruchnahme weder automatisch zu einem Misshandlungsverdacht und unangemessenen Folgeabklärungen führt noch zum Aushebeln des Screenings?
Geringer scheinen diese Risiken bei verdachtinduzierten Verfahren. Hier werden diagnostische Instrumente erst eingesetzt, wenn bereits die Vermutung besteht, dass ein Fall innerfamiliärer Gewalt vorliegen könnte. Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt allerdings darin, dass sie das grundsätzliche Problem einer ungenügenden Erkennung nicht entscheidend vermindern: Wenn Fachpersonen erst bei einem Verdacht auf Instrumente zurückgreifen können, bleibt die Frage ungelöst, wie sie auf systematische Weise zu diesem Verdacht kommen.
All diese Faktoren tragen dazu bei, dass Fachpersonen standardisierte Instrumente bisher äusserst zurückhaltend einsetzen – nicht nur in der Schweiz, sondern auch international. Stattdessen scheinen zumindest in der Schweiz vor allem nicht standardisierte Verfahren angewendet zu werden.
Vielfalt an Früherkennungsmassnahmen in der Praxis Die Ergebnisse der telefonischen Befragung von 159 praktizierenden Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz zeigen zunächst einmal, dass diese – mit Ausnahme zweier Befragter – bereits heute Massnahmen zur Früherkennung innerfamiliärer Gewalt anwenden. 82 Prozent der Befragten gingen verdachtinduziert vor. Nur 11 Prozent verwendeten ein standardisiertes Instrument, stattdessen wurden überwiegend Gespräche mit den Patientinnen und Patienten sowie Beobachtungen genutzt. Verbindliche Vorgaben zum Umgang mit einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen scheinen dabei eher die Ausnahme zu sein: Nur 20 Prozent der Befragten gaben an, dass es in ihrer Praxis bzw. Institution verbindliche Vorgaben gebe. Entsprechend wiesen die Aussagen der Befragten auf Unsicherheiten beim Vorgehen in Verdachtsfällen hin. Hintergrund ist jedoch vermutlich nicht allein das Fehlen von Vorgaben, sondern ebenso der Umstand, dass das Thema Früherkennung innerfamiliärer Gewalt bisher mehrheitlich nicht systematisch in der Aus-, Weiter- und Fortbildung von Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz verankert ist, wie die Ergebnisse der Curriculaanalyse zeigen und die befragten Expertinnen und Experten bestätigen. Und auch die im Rahmen der Studie analysierten Empfehlungen enthielten beispielsweise nur wenige Angaben zur adäquaten Gestaltung der Gespräche mit den Patientinnen und Patienten.
Zur Absicherung der eigenen Beobachtungen diente den Befragten stattdessen die (oft interdisziplinäre) Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen – sei es in Form von Fallbesprechungen (35 %), der Besprechung mit einer Kindesschutzgruppe (KSG) bzw. einem Child-Abuse-and-Neglect-Team (CAN-Team; 15 %) oder in Form von Rücksprachen mit anderen in den Fall involvierten Fachpersonen (z. B. Pädiater/-in; 10 %). Die beschriebenen Vorgehensweisen sind sowohl durch den jeweiligen professionellen Auftrag und die jeweilige Arbeitsweise (z. B. therapeutische Gesprächstechniken) beeinflusst als auch durch die örtlich etablierten Strukturen und Traditionen. Beispielsweise setzten sich in Verdachtsfällen insbesondere die befragten Gesundheitsfachpersonen aus der Deutschschweiz (30 %) sowie Klinikangestellte (25 %) mit KSG / CAN-Teams in Verbindung. Letzteres lässt sich vermutlich mit dem erleichterten Zugang zu den an Kinderspitälern installierten KSG erklären. Zudem ist in einer Klinik allgemein der Zugang zu Angehörigen anderer Berufs- oder Fachgruppen erleichtert, was erklären kann, dass die befragten Klinikangestellten (43 %) im Vergleich zu den Praxismitarbeitenden (27 %) auch diese Massnahme häufiger nannten. Durch die KSG / CAN-Teams ist das Thema «Kindesschutz» im Spital zudem institutionalisiert und – so der Eindruck aus den Interviews – die Gruppen bzw. Teams geben klare Handlungsanweisungen für den Verdachtsfall vor.
Schweizweite Einführung von Früherkennungsmassnahmen – ja, aber wie? Die befragten Gesundheitsfachpersonen äusserten in verschiedener Hinsicht Bedenken gegenüber Früherkennungsmassnahmen: So wiesen sie etwa auf die Gefahr hin, dass sich daraus ein Vertrauensverlust oder gar ein Kontaktabbruch durch die Patientinnen und Patienten bzw. die Kindseltern ergeben könne oder dass unnötige Belastungen für die Familien entstünden. Dennoch sprach sich die Mehrheit für eine flächendeckende Einführung von Früherkennungsmassnahmen aus (81 %). Weniger Einigkeit bestand jedoch bezüglich der genaueren Ausgestaltung dieser Massnahmen, wobei auch hier wieder der jeweilige Handlungskontext sowie existierende regionale Strukturen und Traditionen eine Rolle spielten. 40 Prozent befürworteten die Einführung eines verdachtinduzierten Vorgehens, 30 Prozent ein generelles Screening, weitere 30 Prozent wollten sich hingegen nicht festlegen. Akzeptanz in der Praxis scheint dabei ein Verfahren zu erhalten, das von verschiedenen im jeweiligen Handlungsfeld relevanten Berufs- bzw. Fachgruppen entwickelt bzw. eingeführt wird. Dies entspricht den im Rahmen der Dokumentenanalyse analysierten Expertenempfehlungen und kann sich nicht nur positiv auf die Akzeptanz der Massnahme auswirken, sondern ebenso auf die Praxistauglichkeit der Instrumente (z. B. Sprachniveau).
Ausblick Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich bis heute national wie international keine breit anerkannte Best Practice der Früherkennung von innerfamiliärer Gewalt durchgesetzt hat – weder im Gesundheits- noch im Bildungssystem oder in der Kinder- und Jugendhilfe. Zwar existieren Screeninginstrumente, die in spezifischen Handlungsfeldern (z. B. der medizinischen Notfallversorgung) an einzelnen Standorten teilweise erfolgreich erprobt worden sind oder werden. Von umfassenden nationalen Strategien, die den Einsatz entsprechender Massnahmen in unterschiedlichen Bereichen fördern und koordinieren, kann jedoch nicht die Rede sein. Hinzu kommt das Problem falsch-positiver Diagnosen. Gerade dieses kann aufgrund des professionellen Selbstverständnisses in den helfenden Berufen zum Widerstand gegen ein systematisches Screening innerfamiliärer Gewalt führen. Die von den befragten Fachpersonen geäusserte Befürchtung, zu direkte Fragen könnten das Vertrauensverhältnis zu den Patientinnen und Patienten gefährden, dürfte die entsprechenden Vorbehalte noch verstärken. Darüber hinaus senken Unsicherheiten über das konkrete Vorgehen bei Verdacht auf innerfamiliäre Gewalt sowie hinsichtlich relevanter rechtlicher Regelungen (z. B. Schweigepflicht) und geeigneter Gesprächstechniken die Bereitschaft, Verdachtsmomenten systematisch nachzugehen.
Mit Blick auf die mögliche Einführung von Massnahmen zur Früherkennung innerfamiliärer Gewalt zeigt die Untersuchung eine Reihe von Faktoren auf, denen hierbei unbedingt Rechnung zu tragen wäre. Insbesondere zu nennen sind:
- Zuschneiden der diagnostischen Instrumente auf den jeweiligen Handlungskontext sowie auf die dortige Funktion der Anwenderinnen und Anwender
- Berücksichtigung des internationalen Forschungsstandes bei der Entwicklung von Instrumenten
- Unterstützung der Entwicklung und Einführung neuer Instrumente durch einflussreiche Akteure innerhalb der Profession (z. B. Berufsverbände)
- Begleitung durch wissenschaftliche Evaluationsstudien, die Aussagen über die psychodiagnostische Güte der Instrumente zulassen und Hinweise auf allfällige inhaltliche Anpassungen oder hinsichtlich einer besseren strukturellen Einbettung geben
- Implementation von handlungsweisenden Konzepten bezüglich des Umgangs mit Verdachtsfällen und bestätigten Fällen
- Schulung der Anwenderinnen und Anwender (inkl. Techniken der Gesprächsführung, unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse vulnerabler Gruppen sowie rechtlicher Aspekte)
Die Studie hat ferner erhebliche Forschungslücken bezüglich der Früherkennung innerfamiliärer Gewalt aufgezeigt. Dies betrifft nicht nur die Evaluation bestehender Instrumente, sondern u. a. auch die Untersuchung von Risiko- und Schutzfaktoren bezüglich künftiger Kindeswohlgefährdungen unter Berücksichtigung schweizerischer Eigenarten sowie die Auswirkung von Früherkennungsmassnahmen auf die Häufigkeit verschiedener Versorgungsleistungen. Die Bearbeitung dieser Themen würde weitere wichtige Grundlagen für die Entwicklung und Implementierung evidenzbasierter Früherkennungsmassnahmen schaffen.
- Literatur
- Krüger, Paula; Lätsch, David; Voll, Peter; Völksen, Sophia (2018): Übersicht und evidenzbasierte Erkenntnisse zu Massnahmen der Früherkennung innerfamiliärer Gewalt bzw. Kindeswohlgefährdungen; [Bern: BSV]. Beiträge zur sozialen Sicherheit; Forschungsbericht Nr. 1/18: www.bsv.admin.ch > Publikation & Service > Forschung und Evaluation > Forschungsberichte.
- Lätsch, David; Stauffer, Madlaina (2016): «Gewalterleben, psychosoziale Beeinträchtigung und professionelle Versorgung gewaltbetroffener Jugendlicher in der Schweiz», in Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz, 1, 71, 1ff.